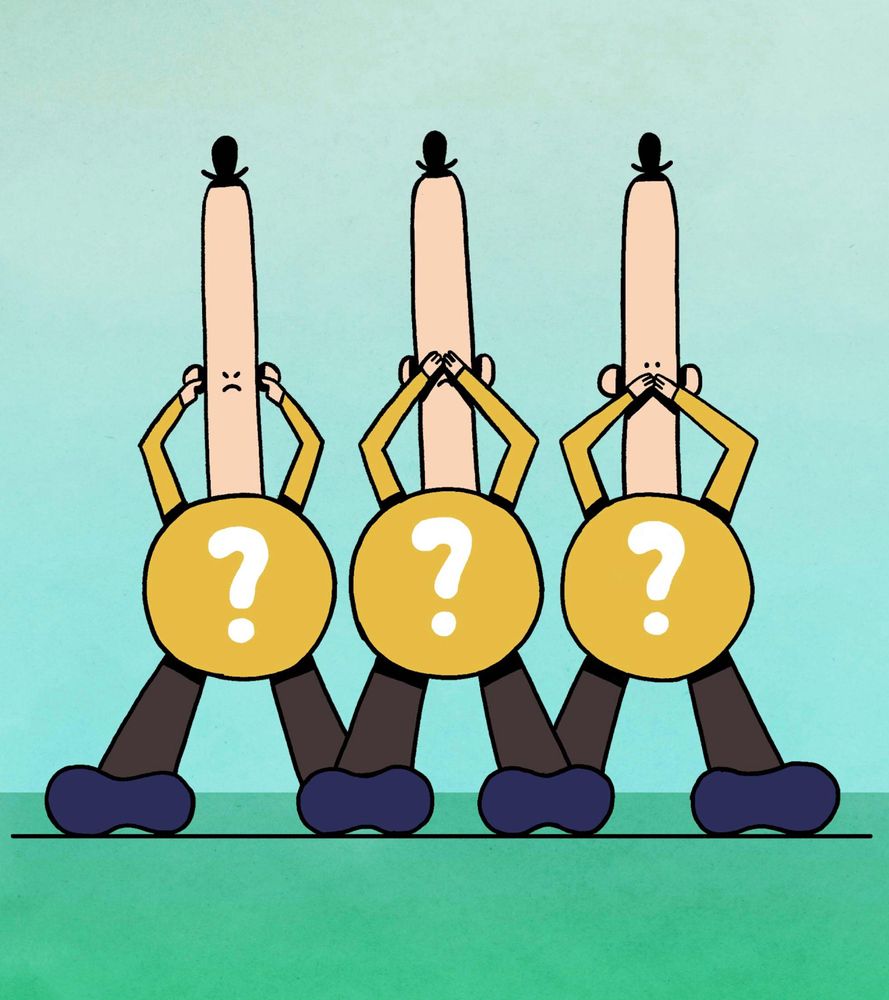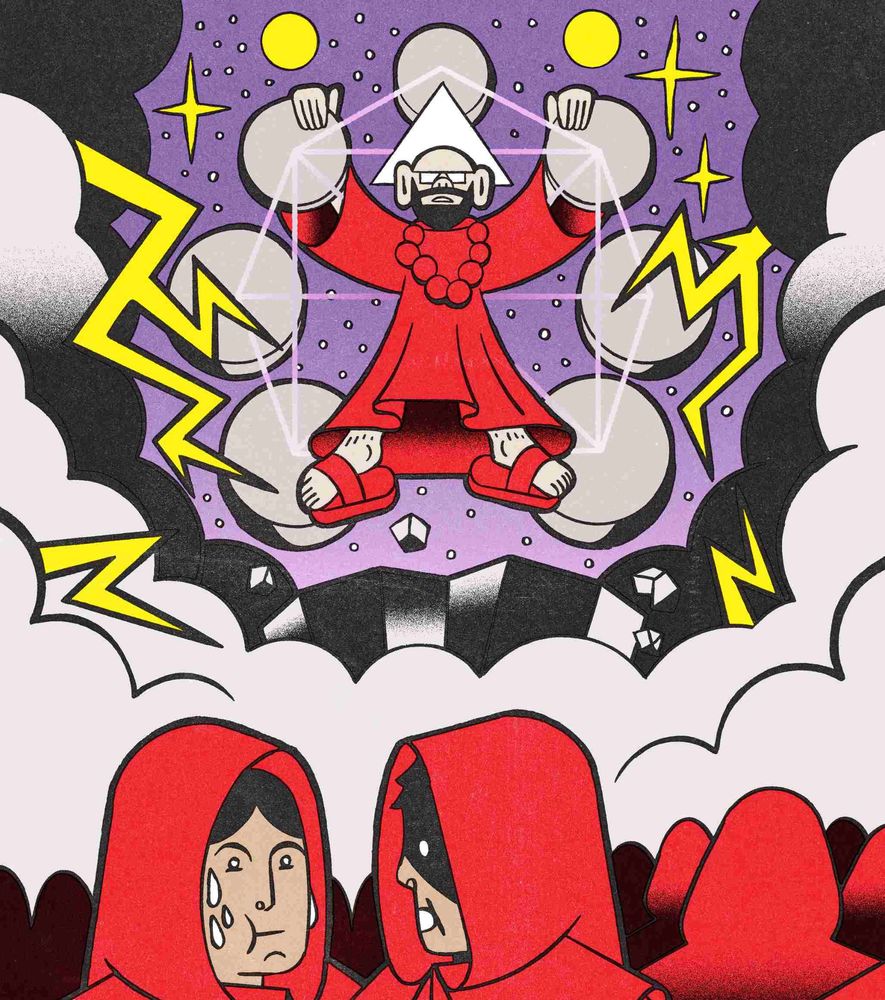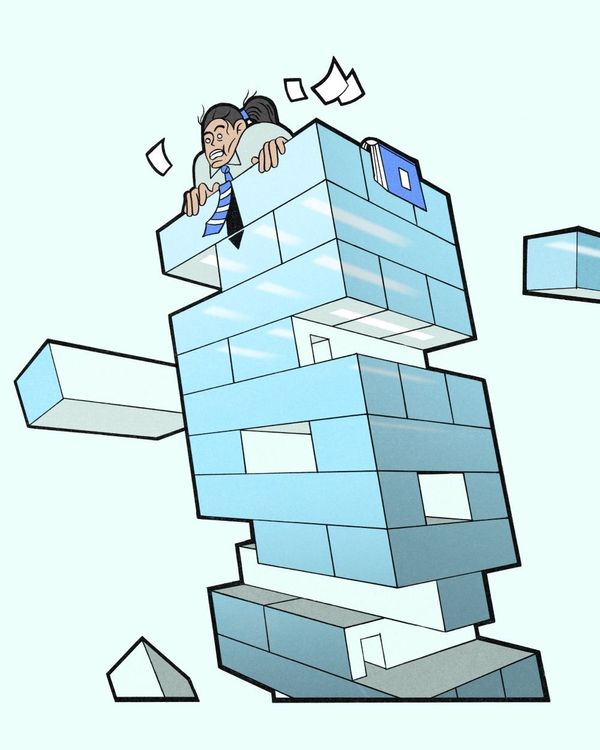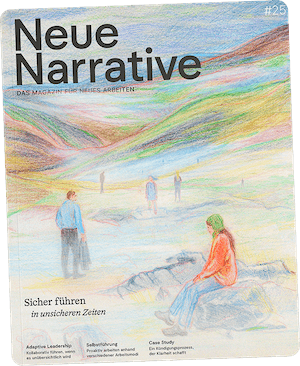In unserer Kolumne Frag Fred geben wir Antworten auf Fragen, die im Kontext von Selbstorganisation immer wieder auftauchen: Diesmal geht es darum, wie sich eine Kultur schaffen lässt, in der sich alle Mitglieder der Organisation trauen, mutig zu sein.
Die Frage
Oft heißt es, Unternehmen bräuchten eine Kultur, in der Fehler akzeptiert werden. In der Menschen mutig sind und Risiken eingehen. Das sei ein Schlüssel für Innovation. Doch in welchem Maß ist das überhaupt sinnvoll? Und wie lässt sich eine solche Kultur gestalten?
Amy Edmondson hat ein Buch geschrieben, in dem es genau darum geht: wie sich eine vertrauensvolle Unternehmenskultur gestalten lässt. Das Buch heißt Die angstfreie Organisation (Original: The Fearless Organization). Die Autorin war die erste, die sich mit dem Konzept der psychologischen Sicherheit beschäftigt hat, das später durch das Aristoteles-Projekt bei Google Bekanntheit erlangte.
Die Kernaussage des Buches lautet: Keine Organisation kann sich heute eine Kultur der Angst leisten. Es gibt sie noch in vielen Unternehmen, doch sie ist zum Relikt aus vergangenen Zeiten geworden. Heute fahren Firmen besser, in denen eine Kultur des offenen Austauschs herrscht, in denen Menschen sich trauen, Risiken einzugehen und auch unangenehme Dinge auszusprechen. Angst ist der Feind der Potenzialentfaltung. Gerade in Umfeldern, die sich schnell ändern und wo Innovationen gefragt sind, können Unternehmen es sich nicht mehr leisten, dieses Potenzial nicht auszuschöpfen.
Eine Kultur der mitfühlenden Ehrlichkeit
LoslegenKultur der Angst und des Schweigens
Es lohnt sich, zunächst einen Blick auf das negative Ende des Spektrums zu werfen: Firmen, in denen eine Kultur der Angst und des Schweigens herrscht. Laut Edmondson war diese Kultur in Zeiten dominant, als „geniale“ Gründer und Ingenieure ihre Mitarbeiter*innen durch Angst und Unterdrückung dazu motivierten, möglichst genau das zu tun, was ihnen gesagt wurde. Das Bild des genialen Chefs, der alle für die Ausführung seiner Ideen (miss-)braucht, passt nicht mehr in unsere Zeit. Und dennoch bestehen Umfelder fort, in denen Angst das Handeln der Menschen prägt.
Es gibt viele Beispiele, die zeigen, wozu das führt: Firmen wie Nokia haben den Wandel der Zeit verschlafen, weil ein dominanter, kalter CEO jeden Widerspruch bestrafte. Menschen in der Organisation hielten daraufhin wichtige Informationen zurück, was das einst so erfolgreiche Unternehmen in eine Sackgasse führte. Im Dieselskandal trat zutage, dass der VW-Vorstandsvorsitzende Winterkorn dafür bekannt war, Menschen einzuschüchtern und bei unangenehmen Nachrichten laut zu werden. Er stand somit an der Spitze eines Unternehmens, in dem Menschen gelernt hatten, lieber zu schweigen, als unangenehme Dinge anzusprechen und lieber wegzuschauen als Bedenken zu Firmenabläufen oder unethischem Verhalten zu äußern.
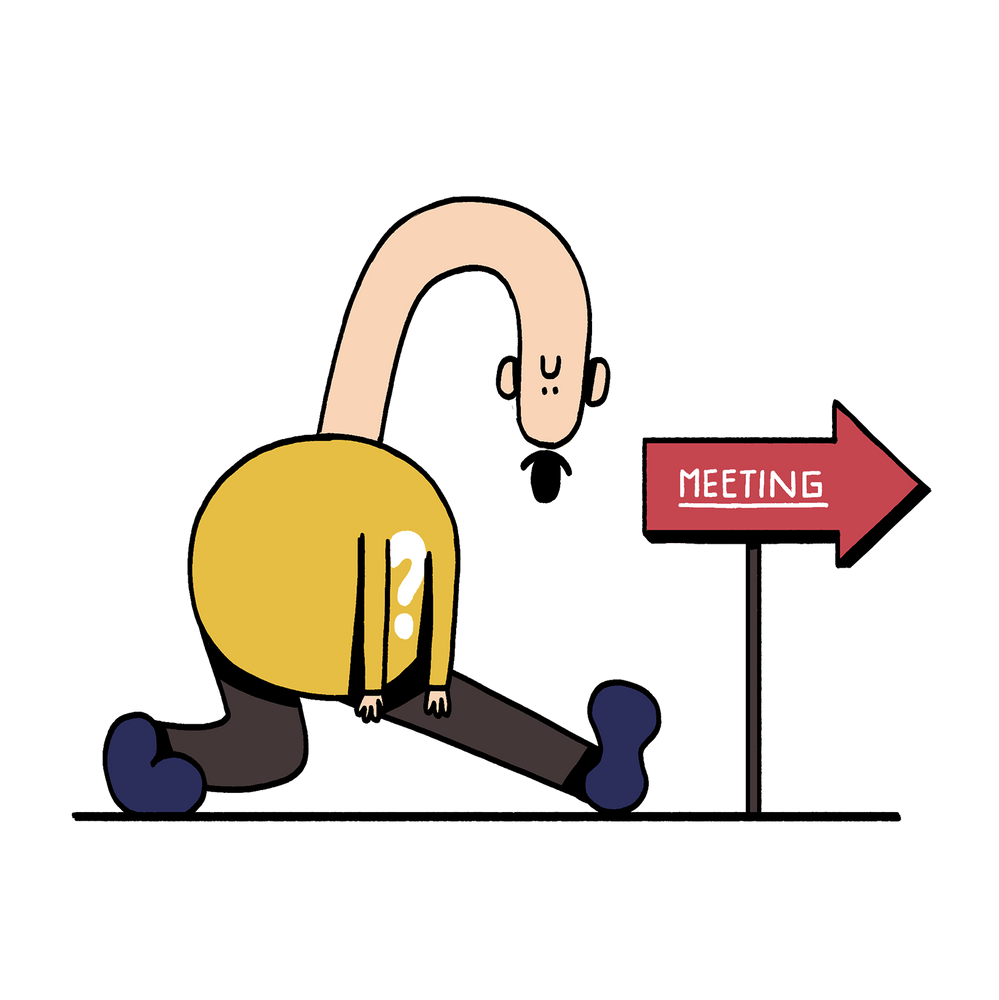
Von der Kultur des Schweigens zur Kultur des Scheiterns
Was hat das alles nun mit dem Mut zu tun, Risiken einzugehen und zu scheitern? Unternehmen brauchen ein intelligentes Scheitern: Das erfordert ein Umfeld, in dem Menschen neue Dinge ausprobieren, die sinnvoll erscheinen, sie aber so schnell wie möglich einstellen, wenn sich zeigt, dass diese Ideen ins Nichts führen. Dazu ist vor allem eine Sache gefragt: Menschen müssen sich trauen, zu sagen, was sie denken. Und zwar auch dann, wenn es potenziell unangenehm ist, wenn wir also beispielsweise eine neue, verrückte Idee vorstellen oder Bedenken äußern, weil wir einen Aspekt sehen, der bislang unbekannt war.
In einer Kultur des Schweigens halten Menschen ihre Ideen, Fragen und Bedenken zurück. Warum? Weil sie Angst haben, die damit verbundenen zwischenmenschlichen Risiken einzugehen. Wir evaluieren unbewusst jede Situation danach: Wie hoch ist das Risiko, gedemütigt, erniedrigt oder sogar aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden? Ist die Sache zu riskant, bleiben wir lieber stumm.
Wo Menschen sich trauen, den Mund aufzumachen, ihre Bedenken zu äußern, Ideen einzubringen und allgemein sie selbst zu sein, spricht Edmondson von psychologischer Sicherheit. Psychologische Sicherheit bedeutet, dass nicht nur zwischen zwei Individuen Vertrauen herrscht, sondern dass wir als Individuum auf der Ebene unseres Teams oder gar der ganzen Organisation das Vertrauen haben, dass unsere Offenheit nicht bestraft oder gegen uns verwendet wird. Auf diese Weise lernen wir, dass Aufrichtigkeit erwünscht ist, dass auch das Zugeben von Fehlern kein Risiko darstellt.
Wo psychologische Sicherheit herrscht, wird Offenheit nicht bestraft.
Von der Kultur des Sagens zur Kultur des Fragens
Was bedeutet es, als Führungskraft (oder als selbstorganisiertes Team) eine Kultur zu schaffen, in der psychologische Sicherheit gegeben ist? Dazu gehört an erster Stelle, dass wirkliche Klarheit darüber besteht, was der Sinn und Zweck der Zusammenarbeit ist und an welchen Zielen aktuell gearbeitet wird. Solang diese Art der Klarheit nicht gegeben ist, wird weder produktiver Dissens noch intelligentes Scheitern möglich.
Was bedeutet es, als Führungskraft (oder als selbstorganisiertes Team) eine Kultur zu schaffen, in der psychologische Sicherheit gegeben ist? Dazu gehört an erster Stelle, dass wirkliche Klarheit darüber besteht, was der Sinn und Zweck der Zusammenarbeit ist und an welchen Zielen aktuell gearbeitet wird. Solang diese Art der Klarheit nicht gegeben ist, wird weder produktiver Dissens noch intelligentes Scheitern möglich.
Sind Richtung und Ziele klar, dann lässt sich eine Kultur psychologischer Sicherheit vor allem durch zwei Werte beschreiben: Aufrichtigkeit und Wertschätzung. Aufrichtigkeit in dem Sinn, dass Menschen ihre Ideen und Einfälle genauso vorbringen wie ihre Kritik und Bedenken. Wertschätzung in dem Sinn, dass ein gegenseitiger Respekt für die andere Person an erster Stelle steht.
Darüber hinaus macht es Sinn, sich den Sprachgebrauch im Team genauestens anzusehen. Wo psychologische Sicherheit herrscht, zeigen Menschen sich verletzlich und sagen Dinge wie:
- „Ich weiß es nicht.“
- „Ich brauche Hilfe.“
- „Ich habe einen Fehler begangen.“
- „Es tut mir leid.“
Generell geht es darum, von einer Kultur des Sagens (in der jede*r immer zu allem etwas zu sagen hat und die Führungskraft versucht, sich so schnell wie möglich eine Meinung zu bilden) zu einer Kultur des Fragens zu kommen: also in eine Haltung der Neugier und der Grundannahme, dass jemand anderes es besser weiß.
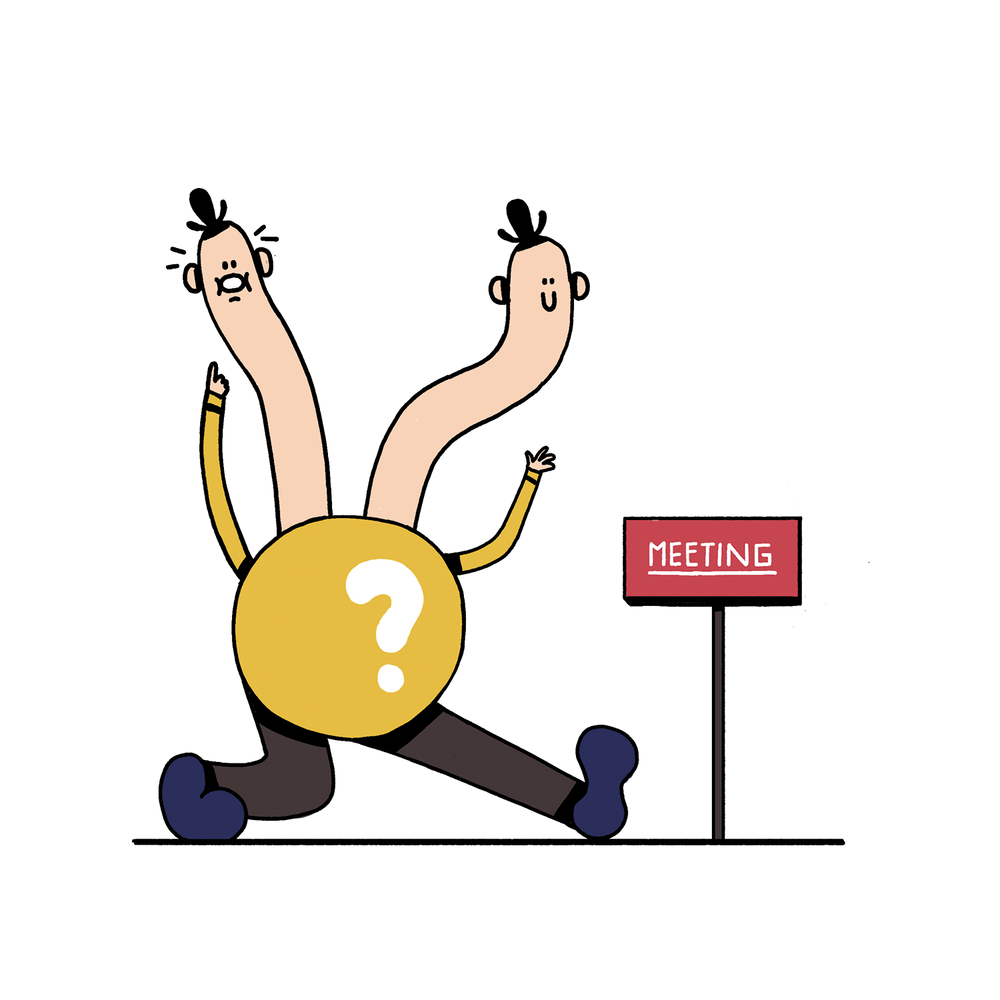
Folgende Leitgedanken können dabei helfen, das Thema im Team etwas tiefer zu erforschen:
- Wie können wir intelligentes Scheitern fördern? Wie können wir Neues ausprobieren, frühes Feedback bekommen und aussichtslose Projekte schnell wieder einstellen?
- Sprechen wir miteinander oder übereinander? Würde es helfen, die Regel einzuführen, grundsätzlich nicht in Abwesenheit anderer über sie zu sprechen?
- Wie können wir verdeutlichen, dass es okay ist, Fehler zu machen, aber nicht okay, sie nicht zu erkennen und aus ihnen zu lernen? Welche Art von Meetings würde uns dabei helfen?
- Verwechseln wir Konflikte und Diskussionen mit einem Wettbewerb? Wie können wir den Gedanken verinnerlichen und leben, dass es in einem Meeting nie darum gehen sollte zu gewinnen?
- Feiern wir unser Scheitern? Belohnen wir es, wenn aussichtslose Projekte eingestellt werden? Niemand scheitert gern, also sollten wir vielleicht Anreize dafür schaffen?
- Gibt es Praktiken bei uns, die erwachsenen Menschen nicht würdig sind (z.B. Rechenschaft darüber abzuliefern, wie wir unsere Zeit verbracht haben)? Können wir diese so schnell wie möglich einstellen?
- Stellen wir sicher (z.B. durch eine starke Moderation), dass Menschen safe spaces bekommen, also nicht unterbrochen und kritisiert werden, wenn sie etwas sagen, das Mut erfordert?
- Lassen wir Menschen manchmal dumm dastehen und falls ja, wie können wir das unterbinden?
- Ist es bei uns möglich, frei von Schuld über Fehler und Scheitern zu berichten? Wie können wir dafür den richtigen Rahmen schaffen?
- Sind unsere Führungskräfte ansprechbar, zugänglich und wissen, dass sie sich irren können? Laden sie proaktiv Beiträge anderer ein und fragen mehr, als sie sagen?
- Üben wir uns in situationsbezogener Demut (z.B.: „Vielleicht habe ich etwas übersehen, was jemand anderes sieht?“)? Wie können wir uns in Neugier und Nicht-Wissen üben?
- Stellen wir ehrlich interessierte Fragen?
- Ist unsere erste Reaktion Wertschätzung für die Person?
Aber ist das eigentlich effizient?
Manchmal entsteht der Eindruck, dass Teams, in denen ein hohes Maß an psychologischer Sicherheit gegeben ist, dadurch langsam und ineffizient werden, weil nur noch über Ideen und Fragen diskutiert wird und am Ende keine Zeit mehr bleibt, die eigentliche Arbeit zu machen. Hier werden allerdings zwei Aspekte miteinander verwechselt: Psychologische Sicherheit bedeutet, dass Menschen ihre Meinungen, Ideen, Bedenken nicht zurückhalten aus Angst davor, dafür bestraft zu werden. Es bedeutet jedoch nicht, dass nicht gleichzeitig klare Regeln dazu existieren, wie effektiv gearbeitet wird. Und dass entsprechend sehr vieles, was gerade nicht hilfreich ist oder nicht den Regeln entspricht, auch nicht gesagt wird.
Psychologische Sicherheit, so Edmondson, löst die Bremsen, die Menschen sonst oft davon abhalten, ihr Bestes zu tun. Sie sind nun nicht mehr damit beschäftigt, sich Sorgen zu machen, ob sie im letzten Meeting dumm aussahen, sondern konzentrieren sich stattdessen auf das Erreichen gemeinsamer Ziele.
Gleichzeitig sind besonders starke Teams sehr bemüht um gute Prozesse, die sie ständig weiterentwickeln, und um sinnvolle Regeln, nach denen gearbeitet wird. Das heißt, dass ein Meeting, in dem psychologische Sicherheit gegeben ist, nicht länger sein muss. Ganz im Gegenteil: Oftmals ist in einer Kultur, in der Dinge an- und ausgesprochen werden können, auch mehr Achtsamkeit dafür gegeben, die gemeinsame Zeit gut zu nutzen.
Wenn ein Meeting ineffizient war oder ein*e Kolleg*in zu viel Zeit in Anspruch genommen hat, wird das ausgesprochen und beim nächsten Mal geändert. Ein Team, das seine Konflikte austrägt und auch mal uneins ist, hat bessere Meetings, weil sie nicht durch ungeklärte Konflikte gelähmt und künstlich in die Länge gezogen werden. Die Menschen können stattdessen produktiv streiten, Experimente wagen, damit scheitern und auch mal erfolgreich sein. Richtig gut arbeiten eben.