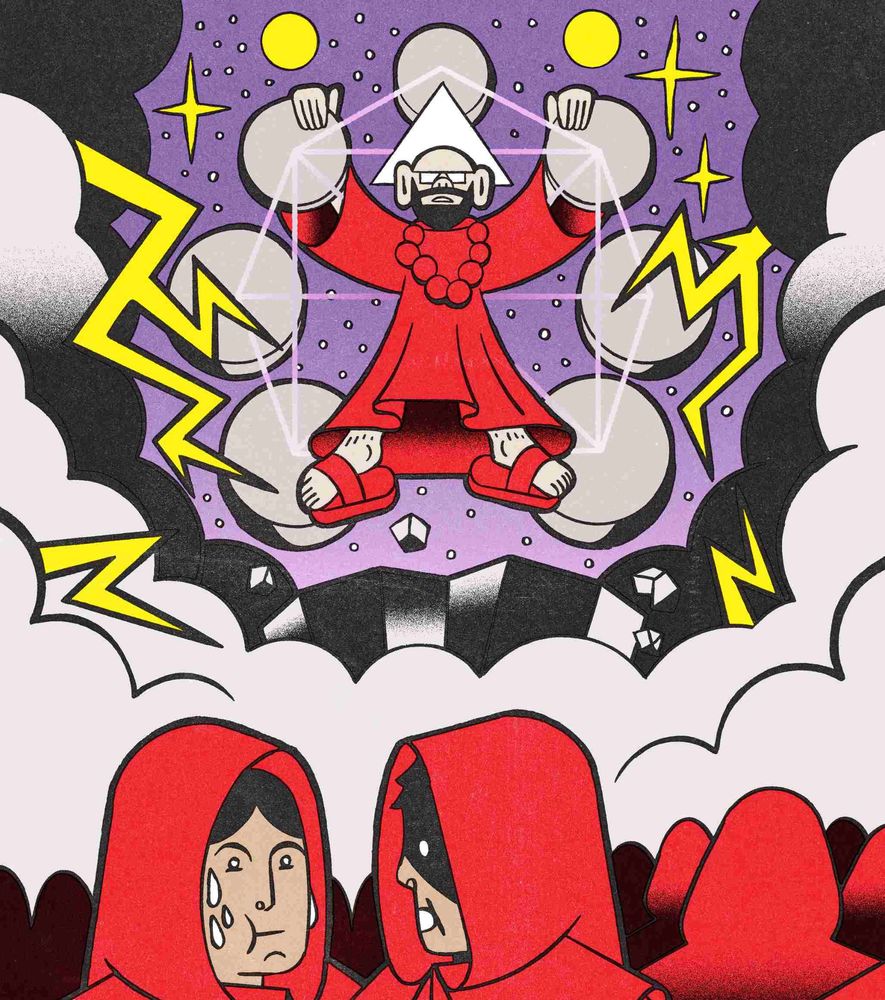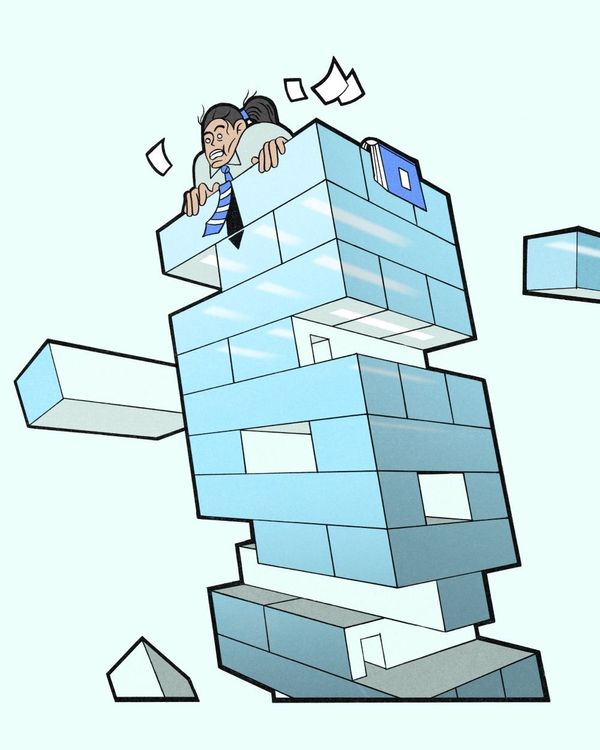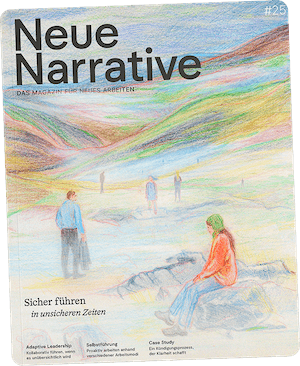Brainstorming ist keine effektive Methode, um Ideen zu entwickeln. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Trotzdem brainstormen wir immer weiter. Warum? Und was ist die Alternative?
Wer nach Ideen sucht und nicht weiter weiß, muss brainstormen. Mit diesem Verständnis wachsen viele Menschen auf. Dabei ist der Prozess meist ziemlich ernüchternd: Drei Personen reden überdurchschnittlich viel, die Hälfte der Gruppe schweigt komplett, irgendjemand fällt ständig (unabsichtlich) ins Wort – und dann ist auch schon die Zeit vorbei. Und das Ergebnis: ein paar mittelmäßige Ideen.
Es gibt viele Theorien dazu, wie die besten Ideen entstehen. Brainstorming gehört erwiesenermaßen nicht dazu, das belegen sozialpsychologische Forschungen seit über 60 Jahren.1
Woran liegt das? Warum ist Brainstorming trotzdem so beliebt? Und was können wir stattdessen tun, um gemeinsam neue Ideen zu finden?

Hol dir eine kostenlose Ausgabe von Neue Narrative
Magazin kostenlos lesenDas Gehirn stürmen
Der Werbefachmann Alex F. Osborn stellte Brainstorming im Jahr 1942 in seinem Buch How To Think Up vor. Den Namen erhielt die Methode nach ihrer Wirkart: das Gehirn stürmen, um ein Problem zu lösen oder Ideen zu generieren. Brainstorming soll sich eignen, um mit einem Thema warm zu werden oder ein Problem mit eher geringer Komplexität zu lösen, Fragen wie: „Was machen wir bei unserem nächsten Teamevent?“ oder „Was ist der Name unseres neuen Produkts?“
Ein*e Moderator*in stellt dafür einer beliebig großen Gruppe eine offene Frage. Die Gruppenmitglieder denken dann in einem festgesetzten Zeitraum laut und dürfen die Ideen, die dabei entstehen, nicht kritisieren. Eine Person protokolliert das Gesagte und weil alle Teilnehmer*innen sich gegenseitig inspirieren, entstehen so in kurzer Zeit viele und gute Ideen. So die Theorie.
In der Praxis läuft es dann meist etwas anders. Das hat zahlreiche Gründe:
„Menschen genießen die soziale Situation, die beim Brainstorming entsteht, überschätzen dabei aber das Ergebnis und den Anteil ihrer eigenen Ideen.“
Stefan Schulz-Hardt, Sozialpsychologe an der Universität Göttingen
- Kontext: Brainstorming wird oft als Selbstzweck eingesetzt. Die meisten Menschen glauben daran, dass es funktioniert und kennen wenige Alternativen. Zeitgleich rückt dabei die Frage in den Hintergrund, wann ein Brainstorming überhaupt sinnvoll ist. So passiert es oft, dass mit Menschen zu einer Frage gebrainstormt wird, zu der sie eigentlich gar nichts zu sagen haben.
- Bewertung: Eine wichtige Regel beim Brainstorming lautet: Keine Idee wird bewertet. In vielen Teams ist diese Grundvoraussetzung aber nicht gegeben: Hierarchien, unausgetragene Konflikte und Konkurrenzgefühle beeinflussen die Art und Weise, wie wir auf unsere Mitmenschen reagieren. Dadurch wird Brainstorming zum Wettbewerb.
- Koordination: Beim Brainstorming soll immer nur eine Person zur Zeit sprechen. Das führt dazu, dass Ideen, die gerade in einem sprudeln, keinen Raum bekommen. Stattdessen vergeht die meiste Zeit und Energie darauf, zu warten, anderen Redebeiträgen zuzuhören und sich abzustimmen. Die Wartezeit beim Brainstorming blockiert also die Kreativität, wie eine Studie vom Sozialpsychologen Wolfgang Stroebe zeigt.2
- Motivation: Osborn ging bei der Entwicklung seiner Methode davon aus, dass Gruppen uns motivieren. Im Fall von Brainstorming ist oft das Gegenteil der Fall: Wir neigen dazu, uns in Gruppen weniger anzustrengen, ein gemeinsames Ziel zu erreichen.3 Diese Tendenz nennt man in der Psychologie soziales Faulenzen. Die Teilnehmer*innen geben sich beim Brainstorming also wenig Mühe, weil sie sich darauf verlassen, dass irgendjemand in der Gruppe schon eine gute Idee haben wird.
- Beeinflussung: Die meisten Menschen nehmen an, beim Brainstorming von anderen inspiriert, also positiv beeinflusst zu werden. Tatsächlich ist die negative Beeinflussung aber nachweislich stärker, denn jede eingebrachte Idee gibt eine Richtung vor, die die Teilnehmer*innen gedanklich einschlagen. Das Ergebnis: weniger und qualitativ schlechtere Ideen, als wenn sie allein nachdenken würden.4
- Persönlichkeiten: In einem Team treffen immer unterschiedliche Persönlichkeiten aufeinander. Extrovertierten fällt es in der Regel leichter als Introvertierten, ihre Ideen in einer Gruppe einzubringen. Im schlechtesten Fall redet beim Brainstorming also nur das lauteste Drittel der Gruppe und der Rest hört zu. Durch diese asymmetrische Kommunikation gehen wichtige Perspektiven verloren, schreibt Susan Cain in ihrem Buch Still: Die Kraft der Introvertierten.
Unterm Strich hemmen Menschen sich beim Brainstorming also in ihren Fähigkeiten. Warum wird die Methode dann trotzdem noch so häufig angewendet? „Das, was uns produktiv macht, und das, was uns Spaß bringt, klafft auseinander“, sagt Stefan Schulz-Hardt, Sozialpsychologe an der Universität Göttingen. „Menschen genießen die soziale Situation, die beim Brainstorming entsteht, überschätzen dabei aber das Ergebnis und den Anteil ihrer eigenen Ideen.“ Brainstorming ist zudem schon seit fast einem Jahrhundert bekannt. Niemand muss sich rechtfertigen, es einzusetzen, die Effektivität zweifelt kaum jemand an.
Was wir stattdessen tun können
Es gibt neben Brainstorming noch viele andere Methoden, die uns dabei helfen, Ideen zu generieren. Wichtig ist bei allen insbesondere eine Frage:
„Was brauche ich?“
Unsere Arbeitswelt ist auf Gruppenprozesse gepolt: Wir verbringen viel Zeit in Meetings, arbeiten in Teams, vernetzen uns. Aus Gewohnheit entscheiden wir uns für ein gemeinsames Brainstorming. Dabei kennen wir die Antwort auf die Frage schon oder wären fähig, sie alleine zu finden. Wir sollten dem Impuls, Verantwortung an die Gruppe abzugeben, häufiger widerstehen. Die wahre Antwort auf die Fragen: Was würde mir gerade am meisten helfen? Was und wen brauche ich, um mein Problem zu lösen?, ist häufig: Ich brauche nur mich. Einzelarbeit ist in unserer Arbeitswelt unterschätzt, wenn es darum geht, Ideen zu finden.
Effektive Gruppenprozesse: Brainwriting
Wenn es doch die Arbeit in der Gruppe sein soll, kann Brainwriting eine gute Alternative sein. Brainwriting ist Brainstorming grundsätzlich sehr ähnlich, löst aber einige Probleme der ursprünglichen Methode. Es wird beispielsweise nicht durcheinander gesprochen, sondern erst mal in Stille geschrieben. Das heißt jede*r brainstormt zunächst alleine und notiert die eigenen Ideen separat auf Post-its. Danach werden die Post-its an ein für alle sichtbares Board gepinnt. In einer zweiten Phase können nun alle die Ideen der anderen noch ergänzen und weiterspinnen. Stefan Schulz-Hardt sagt dazu: „Jede*r generiert erst mal für sich Ideen. Und wenn die eigene Produktivität ausgeschöpft ist, dann, erst dann, sieht man, was die anderen gedacht haben.“ Soziales Faulenzen oder negative Beeinflussung können so nicht einsetzen – Stimulation dagegen schon.
Rollen festhalten
Die Walt Disney-Methode legt nahe, ein Problem oder eine Idee aus verschiedenen Rollen zu betrachten wie beispielsweise Träumer*in („Alles ist möglich!“), Macher*in („Wie gestalten wir die Umsetzung?“) und Kritiker*in („Welche Probleme könnten auftreten?“). Es wird also am Anfang festgehalten, wer für die Entwicklung der Ideen, wer für die Umsetzung und wer für die Einordnung zuständig ist. Im Idealfall werden die Rollen kompetenzbasiert verteilt, sodass die persönliche Ebene in den Hintergrund rückt.
Am Ende funktionieren Kreativmethoden nur, wenn sie zu dem passen, was ein Team gerade braucht. Und das heißt Brainstorming sollte nicht die universelle Antwort auf jede co-kreative Frage sein.
Wer trotz allem dennoch brainstormen will, kann dabei einige Regeln beachten:
Klärt den Kontext!
Am Anfang solltet ihr herausfinden, um welche Art von Ideenfindung es sich gerade handelt: Habt ihr schon eine Idee im Kopf und braucht zu dieser noch vertiefendes Feedback von ausgewählten Menschen? Habt ihr ein offenes Spannungsfeld identifiziert, zu dem euch der Input von möglichst vielen Menschen interessiert? Es geht hier vor allem um das Bewusstsein, wann Brainstorming sinnvoll ist und wer etwas zur Lösung des Problems beitragen kann.
Nutzt verbindende Sprache statt Bewertung!
Versucht das Wort „aber“ zu vermeiden und nutzt stattdessen „und“, wenn ihr eine Idee in den Raum werft. Damit signalisiert ihr, dass ihr die Ideen der anderen nicht bewertet, sondern aufeinander aufbaut. Sätze wie „Das ergibt doch keinen Sinn!“ sind beim Brainstorming unerwünscht. Ihr arbeitet miteinander, nicht gegeneinander.
Wählt eine*n Facilitator*in!
Gutes Brainstorming braucht eine Person, die die Regeln im Blick hat. Ein*e Facilitator*in sollte möglichst objektiv sein, einen geeigneten Raum für die Brainstorming-Session wählen, die Zeit im Blick haben und sicherstellen, dass alle Menschen zu Wort kommen, die etwas zu sagen haben. Vor allem zurückhaltende Teilnehmer*innen können durch sanfte Steuerung eines*einer Moderator*in ermutigt werden, sich einzubringen.
Legt eine präzise Ausgangsfrage fest!
Damit Brainstorming zu guten Ergebnissen führt, muss die Ausgangsfrage klar und präzise sein. Sie sollte nicht zu breit und nicht zu kleinteilig sein. Es liegt vor allem in der Verantwortung der Moderationsrolle, nachzufragen, ob alle Teilnehmer*innen das Problem verstanden haben. Wenn die Gruppe beim Brainstormen den Faden verliert, sollte der*die Moderator*in sie wieder auf das Ziel aufmerksam machen.
Produziert auf Masse!
Lasst euch keine Zeit dafür, über die Qualität der Ideen nachzudenken. Sprecht schnell und ohne zu denken. Konzentriert euch im ersten Schritt darauf, so viele Ideen wie möglich zu sammeln. Um soziales Faulenzen zu vermeiden, könntet ihr eine minimale Anzahl an Ideen festlegen, die jede*r ungefähr generieren sollte.
Denkt groß!
Keine Idee ist zu groß oder absurd, um sie auszusprechen. Es gibt beim Brainstorming keine Grenzen. Häufig sind die Ideen, die erst mal abwegig erscheinen, besonders inspirierend für andere. Traut euch, noch mal einen ganz anderen Weg einzuschlagen, wenn euch die Ideen dazu gerade kommen. Auch derdie Moderatorin kann die Gruppe noch mal in eine andere Richtung lenken.
Nächste Schritte festlegen!
Ein gutes Meeting sollte nachbereitet werden und das Gleiche gilt auch für ein Brainstorming. Man möchte schließlich respektvoll mit der Zeit umgehen, die alle für das Brainstorming investiert haben, und sicherstellen, dass nach kurzer Zeit nicht wieder zum gleichen Problem gebrainstormt werden muss. Fragt euch also, welche nächsten Schritte Sinn ergeben, ob ihr beispielsweise Prototypen testen möchtet und nach welchen Kriterien ihr dabei entscheidet, was gute und schlechte Ergebnisse sind. Dieser Schritt gehört nicht mehr zum Brainstorming im klassischen Sinne, schließt aber sinnvoll an und stellt sicher, dass die finale Entscheidung für eine Idee nicht auf Macht, sondern messbaren Kriterien beruht – und dass mit den generierten Ideen auch tatsächlich etwas passiert. Denn ohne nächste Schritte sind Ideen eben einfach nur das: Ideen.
Ein gutes Ergebnis
Fest steht also: Wer nach Ideen sucht, sollte sich vorab einen Moment nehmen und reflektieren: Was wissen wir über das Problem? Und was und wen brauchen wir, um es zu lösen? Sich diese Fragen zu beantworten, bevor ein kreativer Schaffensprozess startet, beeinflusst das Ergebnis positiv. Denn am Ende funktionieren Kreativmethoden nur, wenn sie zu dem passen, was ein Team gerade braucht. Und das heißt Brainstorming sollte nicht die universelle Antwort auf jede co-kreative Frage sein.
Takeaways
- Schon seit über 60 Jahren zeigen sozialpsychologische Studien, dass Brainstorming ineffizient ist. Doch der Mythos, Brainstorming führe zu guten Ideen, hält sich bis heute.
- Brainwriting kann eine wirksame Alternative sein. Dabei generiert jede*r erst mal für sich Ideen, erst im Anschluss wird gesammelt und ergänzt. Viele negative Effekte, die durch Gruppendynamiken entstehen, fallen so weg.
- Bei allen Kreativitätstechniken gilt: Sie funktionieren nur, wenn alle Teilnehmenden im Vorfeld wissen, was deren Ziel ist. Die Reflexion darüber sollte mehr Aufmerksamkeit bekommen.
FUßNOTEN
- 1
Mullen / Johnson / Salas (1991): „Productivity Loss in Brainstorming Groups: A Meta-Analytic Integration“, in Basic and Applied Social Psychology, Nr. 12, S. 3-23. ↩
- 2
Stroebe & Nijstad (2004): „Warum Brainstorming in Gruppen Kreativität vermindert“, in Psychologische Rundschau, Nr. 55, S. 2-10. ↩
- 3
Paulus & Dzindolet, (1993): „Social influence processes in group brainstorming“, in Journal of Personality and Social Psychology, Nr. 64, S. 575–586. ↩
- 4
Taylor / Berry /Block (1958): „Does group participation when using brainstorming facilitate or inhibit creative thinking“, in Administrative Science Quarterly, Nr. 3, S. 23–47. ↩