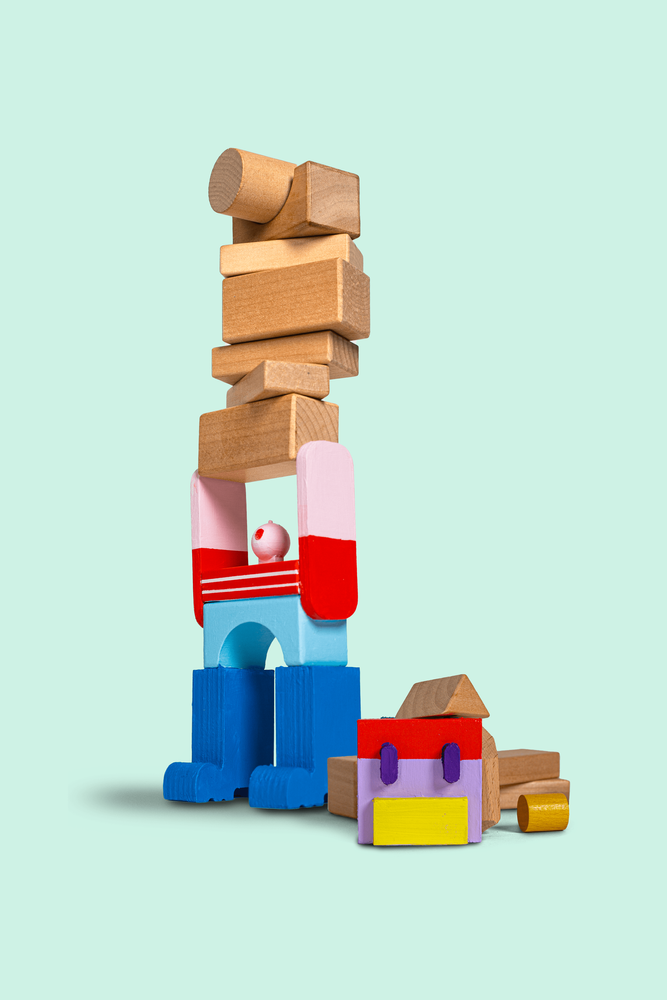In dieser Kolumne untersuchen wir die Macht der Floskeln und Wörtchen, die in der Arbeitswelt den Unterschied zwischen konfliktschürender und konstruktiver Kommunikation ausmachen. Diesmal geht es um egofreie Sprache und den sinnvollen Umgang mit Personalpronomen.
In Kick-off-Meetings, Quartalsretrospektiven und Steuerungskomittees wimmelt es von Aussagen wie „Ich habe ja von Anfang an gesagt, dass das nicht klappen wird“, obwohl fraglich ist, ob das jemanden interessiert beziehungsweise wen diese Aussage schlecht dastehen lässt. Genauso oft fallen Sätze, die mit „wir“ oder „man“ beginnen, obwohl nur eine einzige Person über ihre Perspektive spricht. Was passiert, wenn jemand behauptet, dass „wir alle hier nicht weiterkommen“? Und wurden beim pseudokonsensualen Urteil „Man merkt ja, dass wir alle hier gerade keine Lust auf das Meeting haben“ wirklich alle im Raum vorher befragt? Im Dschungel der unbedachten Personalpronomen gehen viele wichtige Informationen verloren und der Austausch wird unkonstruktiv. Warum ist das so – und wie kann ein besserer Umgang damit gelingen?
Deine Gratis-Ausgabe
Hier sichernPersonalpronomen dienen dazu, bereits bekannte Nomen zu ersetzen. Dafür braucht es ein Verständnis dafür, auf wen sich die Sprechenden beziehen. Wenn wir diese Pronomen unbedacht verwenden, ohne uns vorher auf einen Rahmen verständigt zu haben, verhindert das, dass die Kolleg*innen richtig entschlüsseln können, wer was genau sagt und tut. Es kann noch dazu zu handfesten Konflikten führen. Das an falscher Stelle eingestreute Superheld*innen-Ich à la „Ich habe das Projekt gerettet“ mündet ziemlich schnell in Frustration, sofern ein ganzes Team Zeit und Mühe in das Projekt gesteckt hat, die hier unterschlagen werden.
Eine konstruktivere Kommunikation braucht ein Bewusstsein dafür, wann welches Fürwort das richtige ist. Oft hängt der unsaubere Gebrauch von „Wir“- oder „Man“-Sätzen damit zusammen, dass sich jemand vor Verantwortung drücken und weniger angreifbar machen möchte. So gelingt es auch Politiker*innen, sich mit dem klassischen Drückeberger-Man elegant von ihren Aussagen zu distanzieren mit einem „Das muss man in aller Deutlichkeit sagen“. „Man muss“ heißt übersetzt so viel wie: „Es ist so, und wenn es nicht so ist, dann hab ich's nicht gesagt.“ So ähnlich ist es im Arbeitsalltag mit dem Wir. Wer sagt: „Wir könnten uns bis Ende der Woche um den Kunden kümmern, oder?“, nutzt den Kuschel-Imperativ und meint eigentlich: „Ich will mich gern raushalten, jemand von euch sollte das tun.“ Die meist unbewusste Strategie dahinter: Gebe ich zu, dass ich keine Lust auf die Aufgabe habe, ernte ich Empörung. Aber wenn ich über „uns“ spreche, kann mich niemand angreifen.
Das Problem dabei: Mit höchster Wahrscheinlichkeit kommen Unverständnis und Gegenwind bei generalisierenden Wir-Formulierungen trotzdem. Sie wirken nämlich anmaßend, wenn die Person nicht gerade von der Gruppe als Repräsentant*in gewählt wurde. „Wir machen das immer so und so“ wird spätestens dann zum Problem, wenn die unpräzise benannten Verantwortlichen nicht mitziehen und Ziele nicht erreicht werden. Wenn es am Ende der Woche um vorzeigbare Ergebnisse geht, fällt großen Wir-Redenschwinger*innen die Frage, wer tatsächlich am Projekt gearbeitet hat, auf die Füße. Besser ist es, innerlich abzuchecken: Was will ich eigentlich kommunizieren? Eine Meinung, ein Urteil, eine Beobachtung oder eine implizite Bitte? Deswegen empfiehlt sich, vor jeder geplanten Wir-Aussage einmal im Kopf durchzugehen, wer mit dem Wir eigentlich gemeint ist – und wenn das ehrlicherweise ich selbst bin, übernehme ich die Verantwortung für meine eigene Position und äußere sie explizit. Die Alternative für das obige Beispiel mit dem angeblich für alle langweiligen Meeting wäre etwa: „Ich empfinde das Meeting als unproduktiv und wünsche mir, dass wir jetzt über die Entscheidung abstimmen.“
Der Trick mit der Unterscheidung von Werturteilen, beobachtbaren Fakten und Bitten ist auch bei der Verwendung von Du-Botschaften wichtig, da sie sehr schnell in einem Anklage-Du inklusive Beurteilungen und Bewertungen münden. Der Psychologe Friedemann Schulz von Thun erklärt in seinem Bestseller Miteinander reden, wie wichtig das Personalpronomen Ich beim Anbringen von Kritik ist, da es die Perspektive der*des Sprechenden eindeutig markiert. Ein wertendes „Du hast mir nicht geholfen“ führt zu Ablehnung, die kritisierte Person geht in den Verteidigungsmodus. Mehr Verständnis erreichst du, indem du den Diskussionspunkt in einer wertfreien Ich-Botschaft formulierst, die auf beobachtbaren Fakten basiert, und dann eine Bitte an das Gegenüber richtest. Etwa so: „Ich habe die letzten drei Abende an unserer Präsentation gesessen und wünsche mir Hilfe. Kannst du heute Abend dein Material einfügen und den Feinschliff der Folien übernehmen?“ Ich-Botschaften sind auch gut, wenn sie dazu dienen, Verantwortung zu übernehmen, indem wir sagen: „Dass es in dem Projekt noch nicht vorwärts ging, ist mein Fehler. Ich erstelle ein Konzept bis Ende der Woche.“

Sinnvolle Anwendungs-gebiete von Personal-pronomen
Ich
- Eigene Wahrnehmung, Beurteilung oder Wunsch: „Ich komme nicht weiter und wünsche mir Unterstützung.”
- Übernahme von Verantwortung: „Ich recherchiere diese Woche unsere Optionen.“
Du
- Beobachtbare konkrete Situation: „Du hast im Meeting eben nichts gesagt. Was war los?“
Wir
- Beobachtbare konkrete Situation für ganze Gruppe: „Wir haben uns heute mit dem Kunden getroffen.“
- Gemeinsam erarbeitete Ergebnisse: „Wir haben gemeinsam abgestimmt.“
Man
- Keine
Weniger angebracht ist das Ich, wenn klar ist, dass jemand die Kontrolle an sich reißen möchte, nach dem Motto: „Ich will euch doch nur zeigen, wie man es richtig macht, daher muss ich in jedem Meeting dabei sein.“ Damit büßen wir Kooperationsbereitschaft der Kolleg*innen ein und stoßen Menschen vor den Kopf, die sich Anerkennung und ein Arbeiten auf Augenhöhe wünschen. So gewinnen wir nur eines: Feinde.

Als Faustregel gilt: Für „Man“ gibt es im Arbeitsalltag keine Daseinsberechtigung, beim „Du“ und „Wir“ solltest du dich nur auf beobachtbare Fakten beziehen, denen die Person oder Gruppe nicht widersprechen kann, und dabei nur die Personen nennen, die wirklich involviert sind oder deren Stimmen explizit eingeholt wurden. Und das „Ich“ benutzt du, wenn deine persönliche Meinung ausgedrückt werden soll oder du Verantwortungsbereitschaft signalisierst. Personalpronomen sind vermutlich nichts, worüber du oft nachdenkst. Wir empfehlen jedoch, mal darauf zu achten, welche du wann wie oft und mit welcher Intention verwendest. Denn eine kleine Veränderung in der eigenen Kommunikation kann nicht nur den Arbeitsalltag für alle Kolleg*innen angenehmer gestalten, sondern auch die Zusammenarbeit verbessern, wenn sich alle respektiert fühlen.