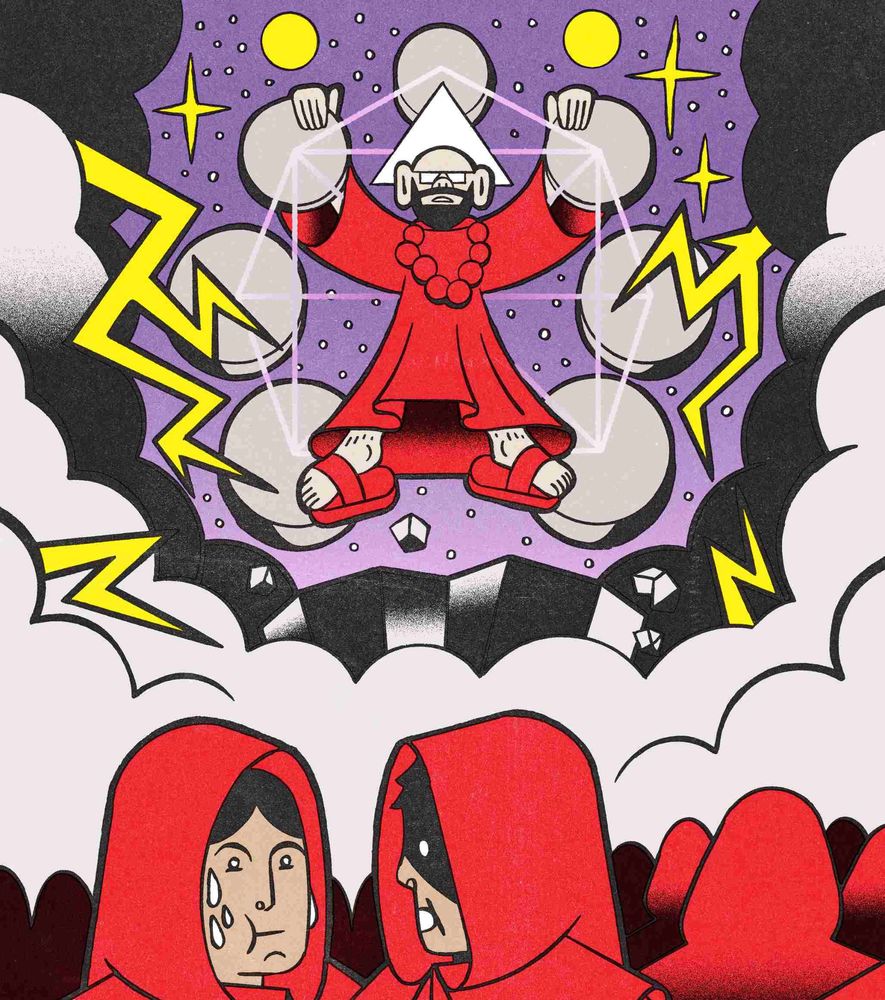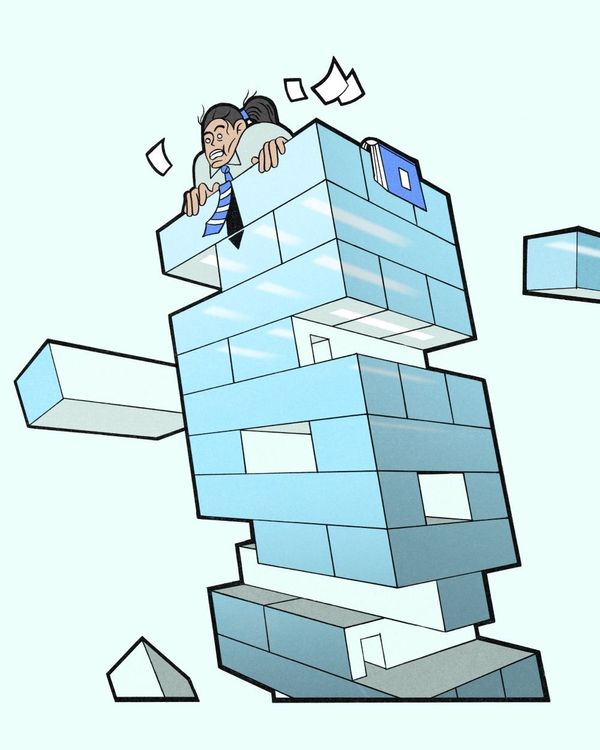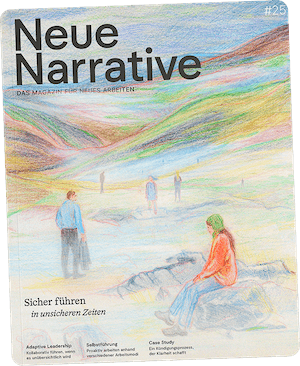Menschen aus den ostdeutschen Bundesländern werden von Spitzenpositionen weitgehend ausgeschlossen und bekommen deutlich schlechtere Gehälter. Wie ändern wir das?
Ich wurde 1984 in Ost-Berlin geboren. Als ich 2022 bei Neue Narrative anfing, trafen wir uns in Brandenburg zum Teamtag. Bei einem Spiel am Lagerfeuer erwähnte ich das Geschichtenlieder-Album Der Traumzauberbaum, das in meiner Kindheit im Osten jede*r kannte. Doch aus der Kolleg*innen-Runde guckten mich alle mit fragenden Blicken an – außer mir kam niemand aus einem ostdeutschen Bundesland. Das hat mich stark verwundert, immerhin waren wir 25 Leute in einem Team mit Sitz in Berlin. Und ich merke in Gesprächen ab und an, dass ich mich mit meiner Perspektive auf manche Dinge ziemlich allein fühle, zum Beispiel wenn irgendwo über die deutsche Geschichte gesprochen wird und damit automatisch die BRD-Geschichte gemeint ist. Dieses Unwohlsein habe ich bei einigen Kolleg*innen in der Redaktion angesprochen und wir wollen das verändern. Neben anderen Faktoren berücksichtigen wir daher seit einiger Zeit auch „Herkunft Ost“ als Pluspunkt auf dem Lebenslauf, um mehr Diversität in unserer Redaktion zu schaffen.
Dass Ostdeutsche in wichtigen Positionen in deutschen Unternehmen fehlen und von manchen Karrieren ausgeschlossen sind, ist kein individuelles, sondern ein gesamtgesellschaftliches Problem, das immer noch gern übersehen oder gar nicht erst thematisiert wird. Ein Grund ist der Glaube an die Leistungsgesellschaft, obwohl wir längst wissen, dass Karrierechancen maßgeblich von der sozialen Herkunft und Privilegien abhängen. Wir wissen, dass es Frauen, Menschen mit Migrationsgeschichte oder Behinderung schwerer auf dem Arbeitsmarkt haben. Doch die innerdeutsche Herkunft ist ein oft vergessener Faktor in der Debatte um Chancengleichheit, obwohl sie eng mit Klassismus und Privilegien verzahnt ist. Denn auch 35 Jahre nach der Wende haben Menschen aus und in ostdeutschen Bundesländern deutlich schlechtere Chancen auf eine klassische Karriere und beruflichen Erfolg als Westdeutsche.
Die innerdeutsche Herkunft ist ein oft vergessener Faktor in der Debatte um Chancengleichheit, obwohl sie eng mit Klassismus und Privilegien verzahnt ist.
Schieflagen zwischen Ost und West
Das fängt bei den Gehältern an: Vollzeitbeschäftigte verdienten 2024 im Osten Deutschlands 21 Prozent weniger als im Westen, also fast 13.000 Euro im Jahr1. Der Germanistikprofessor und Publizist Dirk Oschmann bezeichnet diesen Unterschied als geographical pay gap und macht auf die Langzeitfolgen dieses Gefälles aufmerksam – unter anderem niedrigere Renten und ein geringeres Vermögen2.
Weiterhin zeigt eine Studie der Universität Leipzig, dass Ostdeutsche bezogen auf ihren Bevölkerungsanteil in Führungs- und Spitzenpositionen stark unterrepräsentiert sind – und zwar nicht nur im gesamtdeutschen Kontext, sondern sogar in den in Ostdeutschland ansässigen Organisationen3. Auf den Leitungsebenen der 100 größten ostdeutschen Unternehmen lag der Anteil Ostdeutscher im Jahr 2022 bei 20 Prozent und auf Stellvertreter*innenpositionen ist er im Jahr 2024 von 52 Prozent auf 27 Prozent gesunken. Insgesamt beträgt der Anteil Ostdeutscher bei Spitzenpositionen in Wissenschaft, Verwaltung, Medien und Wirtschaft durchschnittlich gerade mal 1,7 Prozent4. Professuren sind beispielsweise an den ostdeutschen Hochschulen fast durchgehend mit Menschen aus dem Westen besetzt, und nur vier der Hochschulrektor*innen der größten ostdeutschen Hochschulen haben eine ostdeutsche Herkunft.
Wie kann es sein, dass wir es nicht schaffen, diese geografische Lücke zu schließen, selbst in der jüngeren Generation, die im selben gesamtdeutschen System groß geworden sind wie ihre westdeutschen Altersgenossen? Es liegt unter anderem an unterschiedlichen finanziellen Voraussetzungen, fehlendem sozialem und ökonomischem Kapital und hartnäckigen Vorurteilen.

Warum machen Menschen aus Ostdeutschland schlechtere Karrieren?
Stigmatisierung und Diskriminierung
Wer aus dem Osten Deutschlands kommt und Karriere machen möchte, ist mit harten Vorurteilen konfrontiert. Ostdeutsche werden häufig klischeehaft als unzufriedene, rückständige Jammerer gesehen, die eine höhere Affinität zu Rechtspopulismus haben. Außerdem wird ihnen oft eine minderwertige Bildung und Faulheit unterstellt. Und auch manche Dialekte – vor allem das Sächsische – gelten als hässlich und stellvertretend für „Ostdeutsch“. Solche Vorurteile führen dazu, dass manche Menschen vom Arbeitsmarkt komplett ausgeschlossen werden. 2010 beispielsweise erhielt eine Ost-Berlinerin eine Absage für eine Stelle und bekam ihre Bewerbungsunterlagen mit dem Vermerk „(-) Ossi“ zurück. Sie berief sich auf das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, verlor ihre Klage aber, weil „Ossi“ keine ethnische Gruppe sei5. Selbst wenn das Argument vor Gericht keinen Bestand hatte, zeigt diese Erfahrung der Ost-Berlinerin, dass allein eine ostdeutsche Herkunft als Ausschlussmerkmal gelten kann. Viele erfolgreiche Ostdeutsche verschweigen daher ihre Herkunft und trainieren sich ihren Dialekt ab, um bessere Chancen zu haben. Zwar gibt es auch Witze über Bielefeld oder knausrige Schwaben, aber für wenige ist es so karriereschädigend, ihre Herkunft öffentlich zu benennen, wie für Ostdeutsche.
Das hat eine lange Geschichte. Nachdem Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg in BRD und DDR geteilt wurde, blieb die BRD Deutschland, während die DDR zur „Ostzone“ erklärt wurde. Bis heute gilt der Westen als Norm, der Osten als Abweichung, mit der Aufgabe, sich anzupassen. Im wiedervereinigten Deutschland wurde das Wissen von in der DDR hoch ausgebildeten Fachleuten als unbrauchbar eingestuft – und es bildeten sich negative Stereotype der vermeintlich ideologisch-verdorbenen Ostdeutschen; von der tragikomischen Zonen-Gaby bis zum moralisch-abgründigen Stasi-Spitzel. Dabei wurde das Bild eines homogenen geografischen Raums gezeichnet: dem Osten.
Oschmann sagt, der Osten wurde durch die dominante westdeutsch geprägte Perspektive gewissermaßen „erfunden“6. Die meisten überregionalen Medien führen den Diskurs über Ostdeutschland anhaltend zynisch und herablassend, auch weil sie zu westdeutschen Konzernen gehören, größtenteils gar nicht in Ostdeutschland angesiedelt sind oder die örtlichen Gegebenheiten kennen. Der Datenjournalist Martin Kopplin hat für die MDR-Dokumentation Es ist kompliziert… Millionen Presseartikel seit 1990 ausgewertet und Schlagworte in eine KI zur Bilderstellung eingespeist, die in Artikeln über Ostdeutschland besonders häufig vorkommen, darunter etwa „machtlos“, „benachteiligt“ und „rechts“. Da KI bekanntlich vorherrschende Stereotype reproduziert, zeigen die Bilder durchweg resignierte Menschen mit herunterhängenden Mundwinkeln in grauem Regenwetter. Solche Darstellungen können zu sich festigenden Vorurteilen führen und selbsterfüllende Prophezeiungen werden, die sich schließlich auch auf dem Arbeitsmarkt zeigen.
Bis heute gilt der Westen als Norm, der Osten als Abweichung, mit der Aufgabe, sich anzupassen.
Prekäre wirtschaftliche Lage
Die Voraussetzung für einen beruflichen Aufstieg, vor allem in leitenden Positionen, ist soziales und ökonomisches Kapital. Und 95 Prozent der einkommensreichen Deutschen kommen aus den alten Bundesländern.7 In der DDR war es nicht möglich, Kapital anzuhäufen, weil Betriebe in staatlichem Eigentum waren und Privateigentum nur begrenzt zugelassen war, Aktienkäufe verboten waren und Immobilien nur zum Eigengebrauch dienten. Das bedeutet, viele ehemalige DDR-Bürger*innen haben weniger zu vererben und kein Kapital, um studierende Kinder zu unterhalten oder ihnen etwas für eine Firmengründung vorzuschießen. Diese jungen Ostdeutschen werden mit weniger Rücklagen in die Arbeitswelt geschickt und können dadurch ein höheres ökonomisches Sicherheitsdenken entwickeln, während steile Karrieren oft in anfangs risikoreichen Berufsfeldern wie der Start-up-Szene oder neuen Technologien liegen. Menschen, die Anfang der 1990er-Jahre ihre Arbeit und ihr Weltbild verloren haben und sich komplett neu erfinden mussten, sind aus guten Gründen vorsichtig und geben dies an ihre Kinder weiter. Wenn also manchmal gesagt wird, Ostdeutsche wären zu wenig risikofreudig für Spitzenjobs, kann es daran liegen, dass sie oder ihre Familien auch mehr Risiko tragen und auf dieser Basis berufliche Entscheidungen treffen.
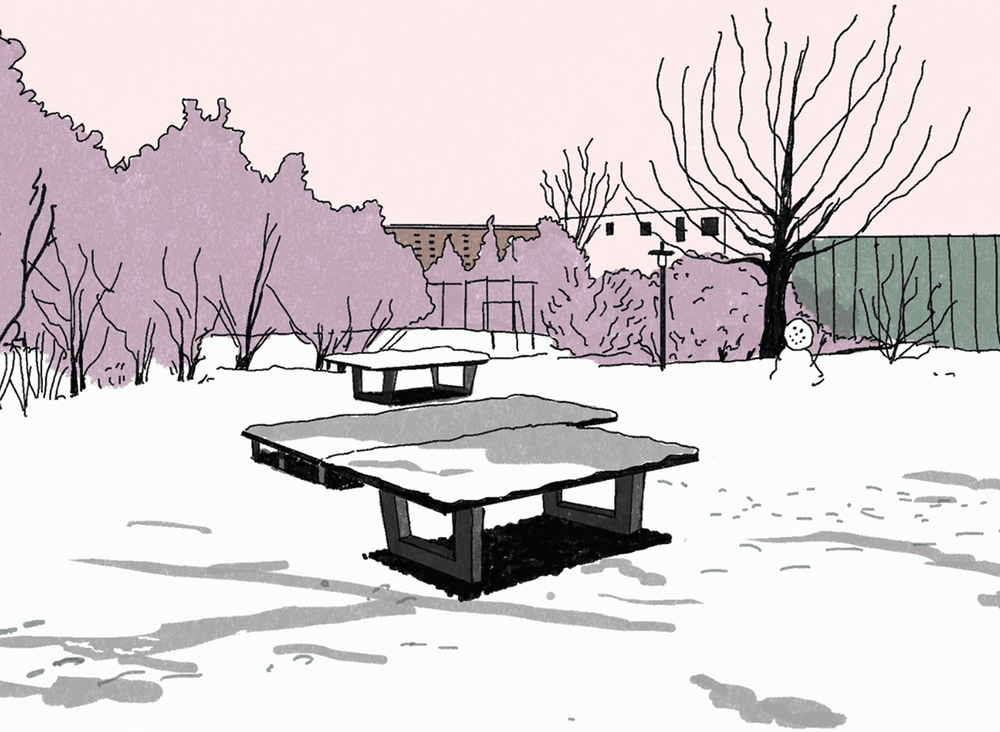
Eliten produzieren Eliten
Ein weiterer Grund dafür, dass Menschen aus Ostdeutschland auch heute noch schlechter in Spitzenpositionen kommen, ist, dass diese größtenteils in eigenen Netzwerken nach dem Prinzip der Ähnlichkeit besetzt werden, sprich: Westdeutsche wählen eher andere Westdeutsche als Nachfolger*innen. Das ist nicht nur in Deutschland so. Der Soziologe Pierre Bourdieu hat bereits in den 1970er-Jahren in seiner Habitusforschung für alle Bereiche der Gesellschaft beschrieben, wie Eliten sich aus sich selbst rekrutieren. Genau das passiert seit der Wende in Ostdeutschland. Nach der Wiedervereinigung privatisierte, sanierte oder liquidierte die Treuhandanstalt DDR-Betriebe in rasantem Tempo, wobei viele Unternehmen abgewickelt wurden und junge, westdeutsche Führungskräfte in Schlüsselpositionen eingesetzt wurden, während ostdeutsche Beschäftigte oft entlassen wurden. Seitdem besetzen diese Führungskräfte neue Stellen in ihrem System mit überwiegend Westdeutschen aus ihren Netzwerken.
Ein Grund dafür kann auch die bewusste oder unbewusste Abgrenzung gegenüber Ostdeutschen sein, weil sie bestimmte Verhaltensweisen oder Gebahren nicht so automatisch verkörpern wie westdeutsche Kolleg*innen. Dem Soziologen Raj Kollmorgen zufolge fehle es Menschen aus Ostdeutschland an „elitären Umgangsformen“, über die Westdeutsche durch die Prägung im kapitalistischen Westen eher verfügen, sowie an „machtvoller Sprache“ und dem „Stallgeruch der Macht“8. Wenn zum Beispiel ein junger Mann aus einer westdeutschen Unternehmerfamilie gelernt hat, wie man sich unter seinesgleichen verhält, welche Wörter man verwendet und welche Etikette in einem bestimmten beruflichen Kontext erwartet wird, kann er sich viel besser anpassen und mit den richtigen Wörtern im richtigen Anzug auch viel besser einen Pitch vor Investor*innen vortragen.
Aber auch der Zugang zu den wichtigen Bildungseinrichtungen und Fachkreisen, in denen sich neue Eliten bilden, ist für junge Menschen aus Ostdeutschland schwieriger. Das liegt unter anderem an der sozialen Struktur: Viele Akademiker*innen sind abgewandert, etwa weil sie selbst nur Karriere in Westdeutschland oder im westlichen Ausland machen konnten. Ein weiterer Grund ist, dass Eltern des ehemaligen Arbeiter- und Bauernstaates noch immer Ausbildungsberufe eher fördern als akademische Laufbahnen. Damit fehlen jungen Menschen, die sich für akademische Laufbahnen entscheiden, auch Vorbilder. Untersuchungen zeigen drittens, dass Kinder sich bei der Berufswahl an den Eltern orientieren. Da diesen Familien oft der Zugang zu Netzwerken und Förderungsmöglichkeiten wie Stipendien oder Mentoring-Programmen fehlt, können sie diese Informationen auch nicht weitertragen. Mentoring-Programme finden hauptsächlich in westlichen Bundesländern statt. Allein der Zugang zu Informationen über mögliche Karrieren kann also verhindern, dass Ostdeutsche sich auf dieselbe Art und Weise am Arbeitsmarkt orientieren können wie Westdeutsche.
Dem Soziologen Raj Kollmorgen zufolge fehle es Menschen aus Ostdeutschland an „elitären Umgangsformen“, über die Westdeutsche durch die Prägung im kapitalistischen Westen eher verfügen, sowie an „machtvoller Sprache“.
Vorurteile verringern und Repräsentation erhöhen
Viele Menschen in Entscheidungspositionen wissen, dass nur 20 Prozent der Spitzenpositionen von Ostdeutschen besetzt sind, aber sehen keinen Handlungsbedarf. „Ich glaube, dass viele Menschen, die westdeutsch sozialisiert sind, sich noch nicht mit ihren Vorurteilen und Klischees auseinandergesetzt haben. Viele haben sich schon mit dem Thema Rassismus beschäftigt. Aber Witzchen über Ostdeutsche zu machen oder einen sächsischen Akzent nachzuahmen, ist total okay“, sagt Melanie Stein, Gründerin der Initiative Wir sind der Osten. Dabei sind die Formen der Diskriminierung natürlich unterschiedlich. Mit Blick auf Ostdeutschland sind sie weniger sichtbar und treten in Form von Stereotypen auf. Wir sind der Osten setzt sich dafür ein, individuelle ostdeutsche Biografien zu erzählen, Erfolgsgeschichten von Engagierten sichtbar zu machen und dadurch ein vielfältigeres Bild von Ostdeutschland zu zeichnen. Unter diesen Biografien finden sich beispielsweise Frauen in Führungspositionen wie nebenan.de-Gründerin Ina Remmers oder Unternehmerin Viola Klein.
Auch in Organisationen ist es wichtig, Vorurteile gezielt abzubauen und zu versuchen, die Repräsentation Ostdeutscher zu erhöhen. Der Ostbeauftragte des Bundestages Carsten Schneider fordert, dass Personen in Entscheidungspositionen dafür sensibilisiert werden, weil viele DAX-Vorstände das Ungleichgewicht nicht reflektieren würden. Auch Antidiskriminierungsbeauftragte vergessen Ostdeutschland als Diskriminierungskategorie häufig, fügt Stein hinzu. Dabei gibt es bei den Ausschlussmechanismen viele Parallelen zu anderen Formen der strukturellen Benachteiligung, etwa von Frauen oder Menschen mit Migrationsgeschichte. Deshalb sollten Organisationen ostdeutsche Beschäftigte beim Thema Chancengleichheit mitdenken: Vorurteile beim Recruiting und bei Personalentscheidungen eindämmen, z.B. bei Einstellungen über unbewusste Vorurteile reflektieren.
Dazu gehört auch, dass Organisationen die Erfahrungen und Perspektiven von Ostdeutschen aufwerten und ihre potenziellen Stärken sehen. Durch gemeinsame Erfahrungswerte gibt es durchaus Eigenschaften, die man unter Ostdeutschen häufiger finde: Remmers zufolge sind Ostdeutsche gut für die Firmenkultur, weil sie in der Regel weniger offensiv auftreten und bescheidener sind9. Das kann in Kontexten neuer Arbeit, die egofreier sein sollte, als Vorbild gelten. Weiterhin bringen viele Ostdeutsche besonderen Einfallsreichtum mit, aber auch die Fähigkeit, sich mit Dingen zu arrangieren. Viele von ihnen haben Zeiten von Mangelwirtschaft und eine fundamentale Transformationserfahrung hinter sich und dadurch Resilienz und Pragmatismus erlernt. Da sich viele Organisationen in der New-Work-Welt sehr flexibel anpassen müssen, haben also auch diese Fähigkeiten einen besonderen Wert.
Eine weitere wichtige Eigenschaft für New Work, die unter Ostdeutschen sehr verbreitet ist, ist Gemeinschaftssinn und Solidarität, der sich in der DDR durch einen starken Zusammenhalt und kooperative Arbeitsweisen zeigte. Nicht zuletzt könnten Organisationen sogar Anregungen für Strukturen bekommen, in denen die DDR sehr gut war, wie etwa eine enge Verzahnung von Theorie und Berufspraxis, Improvisationstalent im Umgang mit begrenzten Ressourcen oder eine hohe Frauen-Erwerbsbeteiligung durch flächendeckende Kinderbetreuung und gleichberechtigte Arbeitsmarktstrukturen. Stein sagt: „Ostdeutsche Frauen haben in der Geschichte des Feminismus in Deutschland eine besondere und oft unterschätzte Rolle gespielt. Die Erfahrungen, die sie in der DDR gemacht haben, haben ihre Sichtweise auf Gleichberechtigung und Feminismus geprägt und beeinflussen auch heute noch die feministische Bewegung. Trotzdem werden bei bundesweiten feministischen Auszeichnungen Frauen aus Ostdeutschland in der Regel selten berücksichtigt.“
„Die Erfahrungen, die ostdeutsche Frauen in der DDR gemacht haben, haben ihre Sichtweise auf Gleichberechtigung und Feminismus geprägt und beeinflussen auch heute noch die feministische Bewegung. Trotzdem werden bei bundesweiten feministischen Auszeichnungen Frauen aus Ostdeutschland in der Regel selten berücksichtigt.“
Melanie Stein – Wir sind der Osten
Chancen strukturell verbessern
Klischees hinterfragen und neue Narrative erzählen ist die eine Sache, die andere Aufgabe von Organisationen ist, die strukturell bedingten Chancen von Ostdeutschen zu verbessern. Das fängt mit dem Versuch an, bewusst mehr Stellen mit Ostdeutschen zu besetzen, um deren Repräsentation zu erhöhen. Die Basis ist, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln und auch Zahlen zu erheben: Wie viele Menschen aus Ostdeutschland arbeiten bei uns? Seit 2017 wird eine Ost-Quote in Führungspositionen ähnlich einer Frauenquote diskutiert. „Aus meiner Sicht braucht es ein hartes politisches Instrument, auch wenn ich das nicht glücklich finde. Man wird um eine Quote nicht herumkommen, wenn man das Teilhabeproblem lösen will“, sagt Oschmann. Er schlägt vor, die Quote ggf. zeitlich zu befristen und unterschiedlich zu gewichten, je nach Standort in Ost- oder Westdeutschland. Organisationen brauchen diesbezüglich aber nicht auf die Politik zu warten. Es gibt in vielen Unternehmen bereits Diversitätsquoten, um Menschen aus benachteiligten Gruppen bei gleicher Eignung vorzuziehen. Der Faktor Herkunft Ostdeutschland lässt sich dort leicht integrieren. In der Politik wird das an manchen Stellen schon erfolgreich umgesetzt. Es gibt z.B. ein Konzept, um die Bundesverwaltung ostdeutscher zu machen.
Allerdings besteht dann immer noch das Problem, dass junge Ostdeutsche dieselben strukturellen Voraussetzungen brauchen wie westdeutsche Kolleg*innen. Ein Schritt dahin ist ein Austausch mit Vorbildern über mögliche Karrierewege und Netzwerke, die von Mentor*innen begleitet werden und in denen Ostdeutsche wichtige Kontakte knüpfen und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten stärken können. Oschmann berichtet von einer Initiative an der Uni Leipzig, die junge Leute aus Nichtakademiker*innenhaushalten besser über Förderungsmöglichkeiten durch Stiftungen wie Teach First oder ArbeiterKind.de zu informieren, die mit Büchergeld, Veranstaltungen, der Finanzierung von Auslandsreisen usw. helfen. Denn: Bisher bewerben sich noch viel zu wenige Ostdeutsche auf solche Hilfen.
Ungeteilte Aufmerksamkeit
Noch immer dürfen Ostdeutsche das Land, in dem sie leben, und die Unternehmen, in denen sie arbeiten, kaum mitgestalten. Das führt nicht nur dazu, dass viele das Vertrauen in Institutionen verlieren, sondern dass wertvolle Perspektiven und Erfahrungen fehlen. Es ist eine gesamtdeutsche Aufgabe, Menschen in Ostdeutschland mehr Teilhabe und Mitgestaltung zu ermöglichen, mal abgesehen von fairer Bezahlung und höheren Löhnen. Westdeutsche haben bis heute extrem von der Wiedervereinigung und der Vermögensungleichheit zwischen Ost und West profitiert. Gleichzeitig haben sie wichtige Perspektiven verschenkt und Potenzial nicht genutzt. Daher ist es ihre Pflicht und ihr Zugewinn, die Schieflage anzuerkennen, Ungleichheit zu beseitigen und Ostdeutschen mehr Karrierechancen zu verschaffen.
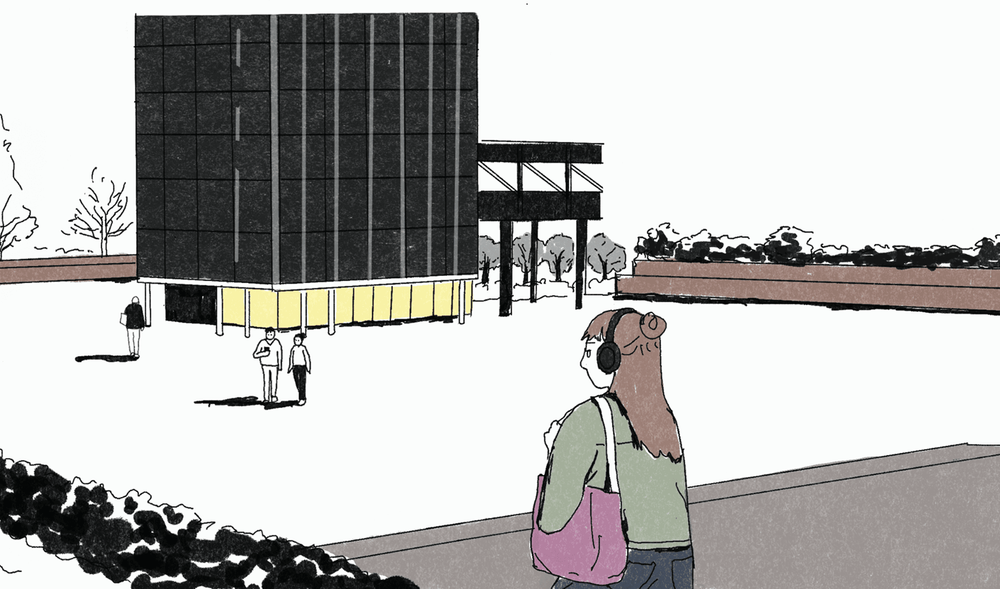
Interviewpartner*innen
Dirk Oschmann ist Literaturwissenschaftler und Publizist. Seit 2011 lehrt er als Professor für Neuere deutsche Literatur am Institut für Germanistik der Universität Leipzig.
Melanie Stein ist Journalistin, Psychologin und Gründerin der Initiative Wir sind der Osten, die Menschen in und aus Ostdeutschland sichtbar macht, die die Zukunft positiv gestalten.
Takeaways
- Ostdeutsche sind in Führungspositionen stark unterrepräsentiert und verdienen weniger als Westdeutsche. Gründe sind fehlendes soziales und ökonomisches Kapital, westdominierte Netzwerke sowie anhaltende Vorurteile und Diskriminierung.
- Karrierechancen hängen stark von bestehenden Netzwerken und kulturellem Kapital ab, von denen Ostdeutsche oft ausgeschlossen sind. Westdeutsche besetzen Spitzenpositionen bevorzugt mit ihresgleichen, während viele ostdeutsche Akademiker*innen abwandern und es an Vorbildern und Mentoring-Programmen fehlt.
- Um Chancengleichheit herzustellen, braucht es strukturelle Maßnahmen wie Quoten für Ostdeutsche in Führungspositionen, gezielte Förderprogramme und eine stärkere Repräsentation in Medien und Entscheidungsorganen. Die Anerkennung ostdeutscher Perspektiven kann Unternehmen und Gesellschaft insgesamt bereichern.
FUßNOTEN
- 1
Handelsblatt: Löhne im Osten mehr als 20 Prozent unter Niveau des Westens (2024) ↩
- 2
Dirk Oschmann: Der Osten: eine westdeutsche Erfindung (2023) ↩
- 3
- 4
Michael Bluhm & Olaf Jacobs: Wer beherrscht den Osten? Ostdeutsche Eliten ein Vierteljahrhundert nach der deutschen Wiedervereinigung (2016), S. 30
↩ - 5
Welt.de: „Ossis“ sind kein eigener Volksstamm (2010) ↩
- 6
Oschmann (2023), S. 16 ↩
- 7
Steffen Mau: Lütten Klein: Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft (2019), S. 163. Unter „einkommensreichen Deutschen“ versteht Mau Personen, die zu den oberen zehn Prozent der Einkommensverteilung gehören. ↩
- 8
Raj Kollmorgen: Ostdeutsche in den Eliten. Problemdimensionen und Zukunftsperspektiven (2017) ↩
- 9
ZEIT ONLINE: Ostdeutsche sind gut für die Firmenkultur (2024) ↩